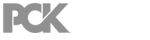Schauspiel
Faust. Eine Tragödie
von Johann Wolfgang von Goethe
Wilhelm Böhm hatte 1933 mit seinem Buch "Faust der Nichtfaustische" das Losungswort ausgegeben. In scharfer Frontstellung gegen die Deutungen der ‚Perfektibilisten', wie er sie nannte, zeichnete er Faust als einen haltlosen, pathologischen Versager. Wenngleich sich dieses Bild in seiner Extremform nicht durchsetzen konnte, so trat doch an die Stelle des Vervollkommnungsschemas mehr und mehr die Auffassung, dass das Leben dieser Figur eher durch ihr Scheitern, ihre Verblendung und ihr Zerstörungspotential gekennzeichnet ist - mit dem Folgeproblem, dass die schlussendliche ‚Himmelfahrt' drastisch an Plausibilität verliert. Was bleibt dann noch? An die Stelle von Gesamtbegriffen des ‚Faustischen' sind wechselnde Teilaspekte getreten, scharfe und zuweilen eher literaturferne Selektionsschablonen, vornehmlich Komposita mit ‚Kritik' (Kapitalismus-, Zivilisations-, Technik- usw.), die kalt staunenden Besuch ermöglichen, und die Festredenhinweise, dass Goethe dieses oder jenes Problem schon damals wahrgenommen oder keine Ahnung gehabt habe.
Aber muss die Einheit immer eine des Aufstiegs sein? In einer der wenigen selbstpublizierten Bemerkungen Goethes über den Faust, in der Ankündigung der Helena in ‚Kunst und Altertum', hat er die Einheit der Figur und der Handlung selbst charakterisiert: Faust wird immer unglücklicher.
Fausts Charakter, auf der Höhe, wohin die neue Ausbildung aus dem alten rohen Volksmährchen denselben hervorgehoben hat, stellt einen Mann dar, welcher, in den allgemeinen Erdeschranken sich ungeduldig und unbehaglich fühlend, den Besitz des höchsten Wissens, den Genuß der schönsten Güter für unzulänglich achtet seine Sehnsucht auch nur im mindesten zu befriedigen, einen Geist, welcher deßhalb nach allen Seiten hin sich wendend immer unglücklicher zurückkehrt.
Diese Gesinnung ist dem modernen Wesen so analog, daß mehrere gute Köpfe die Lösung einer solchen Aufgabe zu unternehmen sich gedrungen fühlten.
Faust, so können wir sagen, ist in der goetheschen Konzeption der Typus der freigesetzten Exklusionsindividualität. Er will sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, und auch in Gretchens Bett sucht er nur im ersten Anfall der Leidenschaft den schnellen Sex; in Wirklichkeit sucht er auch da das Ganze. Findet es aber nicht, und damit ist die ‚Ewigkeit' schon vorbei.
Die funktionale Differenzierung und damit die Exklusion der Individualität und die offene oder latente Konkurrenz von Subsystemen gehen einher mit einer drastischen Steigerung von Kontingenz, d. h. dem Bewusstsein, dass nichts notwendig so ist, wie es ist, und dass alles ebenso gut anders sein könnte. Es sind zwei Dimensionen, die solche Kontingenz aus der Sicht des Subjekts annehmen kann, eine euphorische und eine depressive. Die euphorische besteht im Gefühl von Freiheit. Wenn nichts notwendig ist und nichts unmöglich, dann unterliegt alles dem menschlichen Gestaltungswillen. Die depressive Dimension aber besteht darin, dass auf nichts mehr Verlass ist, dass die Welt immer unberechenbarer wird.
Damit wird sichtbar, was Faust eigentlich erstrebt: Nicht um ‚Wissen' geht es, sondern um die Verankerung seiner Existenz in einem Notwendigen. ‚Wissen' ist das moderne Fundierungsmittel, das an die Stelle der alten Glaubensgewissheiten treten soll. Damit wird dem Wissen aber eine Begründungslast auferlegt, der es nicht gewachsen ist - es sei denn, es träte wieder in Gestalt von Heilswissen auf. Daran gemessen ist das Wissen der vier Fakultäten tatsächlich nur kontingenter Partikularkram. Faust will "nicht mehr in Worten kramen". Die Wortfeindlichkeit ist sicheres Indiz des Wissensfundamentalismus, dem es nicht um Repräsentation der Welt im Gedanken geht, sondern um den direkten Zugang zu den Dingen, "die Empfindung von der Gegenwart der Dinge", Weltpräsenz.
Kein Zweifel, Goethe verstößt gegen das Prinzip der poetischen Gerechtigkeit, gegen das unausrottbare Bedürfnis, dass es wenigstens auf dem Theater gerecht zugehen möge. Man kann den Verstoß dadurch heilen, dass man die Geschichte Fausts doch noch zur Erfolgsgeschichte umdichtet, indem man ihn zum Vollstrecker ‚geschichtlicher Notwendigkeit' (die Lösung der ‚materialistischen' Geschichtsphilosophen) oder einer ‚Dasein-ist-Schuldigsein'-Ideologie macht. Man kann den Verstoß aber auch stehen lassen und auf seine semantische Dimension abhorchen. Er ist dann Index für einen Ebenenwechsel: Wir befinden uns gar nicht mehr auf der Ebene von Strafe und Belohnung für normenwidriges und normenkonformes Handeln, sondern auf einer tieferen (oder höheren), auf der der Wert oder Sinn des menschlichen Lebens überhaupt abgehandelt wird und auf der es dann heißen kann: "Wie es auch sei, das Leben, es ist gut" - nicht nur das der Heiligen, sondern jedes, auch das Fausts.
Karl Eibl
Aber muss die Einheit immer eine des Aufstiegs sein? In einer der wenigen selbstpublizierten Bemerkungen Goethes über den Faust, in der Ankündigung der Helena in ‚Kunst und Altertum', hat er die Einheit der Figur und der Handlung selbst charakterisiert: Faust wird immer unglücklicher.
Fausts Charakter, auf der Höhe, wohin die neue Ausbildung aus dem alten rohen Volksmährchen denselben hervorgehoben hat, stellt einen Mann dar, welcher, in den allgemeinen Erdeschranken sich ungeduldig und unbehaglich fühlend, den Besitz des höchsten Wissens, den Genuß der schönsten Güter für unzulänglich achtet seine Sehnsucht auch nur im mindesten zu befriedigen, einen Geist, welcher deßhalb nach allen Seiten hin sich wendend immer unglücklicher zurückkehrt.
Diese Gesinnung ist dem modernen Wesen so analog, daß mehrere gute Köpfe die Lösung einer solchen Aufgabe zu unternehmen sich gedrungen fühlten.
Faust, so können wir sagen, ist in der goetheschen Konzeption der Typus der freigesetzten Exklusionsindividualität. Er will sehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, und auch in Gretchens Bett sucht er nur im ersten Anfall der Leidenschaft den schnellen Sex; in Wirklichkeit sucht er auch da das Ganze. Findet es aber nicht, und damit ist die ‚Ewigkeit' schon vorbei.
Die funktionale Differenzierung und damit die Exklusion der Individualität und die offene oder latente Konkurrenz von Subsystemen gehen einher mit einer drastischen Steigerung von Kontingenz, d. h. dem Bewusstsein, dass nichts notwendig so ist, wie es ist, und dass alles ebenso gut anders sein könnte. Es sind zwei Dimensionen, die solche Kontingenz aus der Sicht des Subjekts annehmen kann, eine euphorische und eine depressive. Die euphorische besteht im Gefühl von Freiheit. Wenn nichts notwendig ist und nichts unmöglich, dann unterliegt alles dem menschlichen Gestaltungswillen. Die depressive Dimension aber besteht darin, dass auf nichts mehr Verlass ist, dass die Welt immer unberechenbarer wird.
Damit wird sichtbar, was Faust eigentlich erstrebt: Nicht um ‚Wissen' geht es, sondern um die Verankerung seiner Existenz in einem Notwendigen. ‚Wissen' ist das moderne Fundierungsmittel, das an die Stelle der alten Glaubensgewissheiten treten soll. Damit wird dem Wissen aber eine Begründungslast auferlegt, der es nicht gewachsen ist - es sei denn, es träte wieder in Gestalt von Heilswissen auf. Daran gemessen ist das Wissen der vier Fakultäten tatsächlich nur kontingenter Partikularkram. Faust will "nicht mehr in Worten kramen". Die Wortfeindlichkeit ist sicheres Indiz des Wissensfundamentalismus, dem es nicht um Repräsentation der Welt im Gedanken geht, sondern um den direkten Zugang zu den Dingen, "die Empfindung von der Gegenwart der Dinge", Weltpräsenz.
Kein Zweifel, Goethe verstößt gegen das Prinzip der poetischen Gerechtigkeit, gegen das unausrottbare Bedürfnis, dass es wenigstens auf dem Theater gerecht zugehen möge. Man kann den Verstoß dadurch heilen, dass man die Geschichte Fausts doch noch zur Erfolgsgeschichte umdichtet, indem man ihn zum Vollstrecker ‚geschichtlicher Notwendigkeit' (die Lösung der ‚materialistischen' Geschichtsphilosophen) oder einer ‚Dasein-ist-Schuldigsein'-Ideologie macht. Man kann den Verstoß aber auch stehen lassen und auf seine semantische Dimension abhorchen. Er ist dann Index für einen Ebenenwechsel: Wir befinden uns gar nicht mehr auf der Ebene von Strafe und Belohnung für normenwidriges und normenkonformes Handeln, sondern auf einer tieferen (oder höheren), auf der der Wert oder Sinn des menschlichen Lebens überhaupt abgehandelt wird und auf der es dann heißen kann: "Wie es auch sei, das Leben, es ist gut" - nicht nur das der Heiligen, sondern jedes, auch das Fausts.
Karl Eibl














 Uckermärkische Bühnen Schwedt
Uckermärkische Bühnen Schwedt